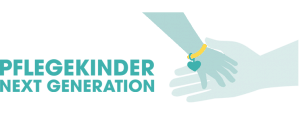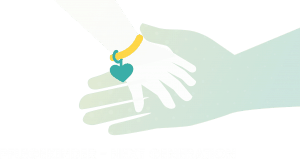«Wir sind Erfahrungsexperten»
Thomas Woodtli war einer der ersten, der sich für die Dialoggruppen beim Projekt «Pflegekinder – next generation» gemeldet hat. Den Austausch mit der Wissenschaft und Politik erachtet das ehemalige Pflegekind als zentral, wie er im Interview ausführt.
Thomas Woodtli – mit 34 Jahren gehören Sie zur Gruppe der «Careleaver». Passt dieser Begriff?
Nein, dieser Begriff ist mir zu unscharf und unbedeutend. Ich bin von meiner Geschichte her schlicht und einfach ein «ehemaliges Pflegekind». Meiner Mutter wurde die Obhut entzogen und so kam ich als Vierjähriger erst für mehrere Jahre in eine Kleinkinderwohngruppe, später wurde ich bei einer Pflegefamilie platziert, bis mich schliesslich die Heimleiterin, die ich von früher kannte, als Pflegekind bei sich aufgenommen hat. Auf meinen Wunsch, wohlgemerkt.
Sie konnten selbstbestimmt mitentscheiden?
Tatsächlich, mit 12 Jahren war für mich klar, wo ich leben wollte. Die verschiedenen Pflegefamilien, die mir vorgestellt wurden, schienen mir keine Option. Und so habe ich die Leiterin der Kleinkinderwohngruppe, wo ich 5 Jahre untergebracht war, gefragt, ob nicht sie mich aufnehmen würde. Das hat sie getan. Emotional war es genau das, was ich wollte. Sie war die erste alleinerziehende Pflegemutter. Von 1999 bis 2012 bin ich bei ihr geblieben, bei Bettina, meiner Freundin.
Besteht auch zu den Herkunftseltern solch eine tiefe Beziehung?
Meine Mutter taucht dann und wann bei mir auf. Ich habe wenig Bindung zu ihr, eher wie zu einer entfernten Verwandten. Mit meinem Vater habe ich sehr selten Kontakt. Bei ihm ist das Verhältnis ebenso wie zu einem entfernten Bekannten.
Schmerzt das?
Nein, denn ich hatte eine glückliche Zeit als Pflegekind erlebt. Ich wehre mich gegen die Vorstellung, dass Kinder den Eltern von den Behörden «weggenommen» werden. Das hat doch meist einen offensichtlichen Grund, auch bei mir, mit einem abwesenden Vater und einer überforderten Mutter. Eine Gefährdungsmeldung war der Auslöser aber nicht die Ursache, dass ich fremdplatziert wurde – und das war auch gut so.
Und doch berichten viele Pflegekinder von Unsicherheiten und Verletzungen.
Nach wie vor heisst es: «Oh, Du bist als Pflegekind aufgewachsen». Oder: «Was hast Du gemacht, dass Du wegmusstest?». Das löst natürlich was aus. All dieses Unwissen und dieses Gerede ist nicht hilfreich und sicher nicht im Interesse der Kinder: Sie erschweren – im ungünstigsten Fall – das Verhältnis zu Pflegeeltern und Herkunftseltern.
Ist das der Grund, warum Sie sich heute engagieren?
Mitunter ja! Es gibt noch viel zu tun. Das habe ich gemerkt. Nach wie vor ist man als «Pflegekind» stigmatisiert. Die Bevölkerung hat kein Wissen und ist nicht sensibilisiert. Sogar Fachpersonen sind oftmals unsicher im Umgang mit Pflegekindern. Von einer gewissen Normalität ist man weit entfernt.
Das wollen Sie ändern – einen Teil Ihrer Arbeitszeit widmen sie den Pflegekindern.
Einen Tag pro Woche bin ich im Jugendhilfe-Netzwerk Integration in Berner Emmental. Dort begleite ich Jugendliche und bin bei den Sitzungen mit dem Psychiater, Sozialarbeiterinnen und Pädagogen als Experte dabei. Als «emotionaler Anwalt» der Pflegekinder, dem man auf Augenhöhe begegnet, der auf diese Punkte hinweisen kann, die den anderen mit ihren Biografien entgangen sind.
Dieser Einbezug der Betroffenen als Experten – ist der aussergewöhnlich?
Ja. Zu oft wird nur über uns gesprochen und zu wenig mit uns. Langsam, langsam beobachte ich aber eine Veränderung. Ein Beispiel: Als ich vor ein paar Jahren bei einer Fachorganisation vorstellig wurde und meine Unterstützung anbot, wusste man erst gar nicht, was mit mir anzustellen sei. Innerhalb eines Forschungsprojektes konnte ich dann aber eine Rolle als Experte einnehmen. Unser Erfahrungsschatz wurde als Wert erkannt. Das war ein unglaublich gutes Gefühl.
Das Forschungsprojekt «Pflegekinder – next generation» arbeitet mit einem partizipativen Ansatz. Ist man da auf dem richtigen Weg?
Ja, definitiv. Ich war Teil der ersten Dialoggruppe. Das hat schwungvoll angefangen in Zürich. Es gab einen tiefgründigen Austausch, sehr facettenreich. Jetzt kommen neue Formen des Austauschs an verschiedenen Orten in der Schweiz dazu. Es braucht uns Betroffene als «Erfahrungsexpertengruppe». Als Gruppe, die nicht nur als Quelle geschröpft wird, sondern die als Gesprächspartner auch später in neu entstehenden Netzwerken eine Rolle einnimmt.
Was erhoffen Sie sich persönlich von diesem Projekt?
Auch wenn vieles in der Pflegekinderhilfe kantonal geregelt ist, muss letztlich national eine Veränderung stattfinden. Der föderalistische Ansatz hat offensichtliche Mängel. Es kann nicht sein, dass in Dörfern, die 5 Kilometer auseinander und in verschiedenen Kantonen liegen, Pflegekinder ganz unterschiedliche Erfahrungen machen. Sie können Glück oder Pech haben. Das geht so nicht. Das Projekt kann hier etwas zum Guten in Bewegung bringen – über die Wissenschaft in die Politik. Damit kann man die Qualität steigern und die Bevölkerung sensibilisieren.